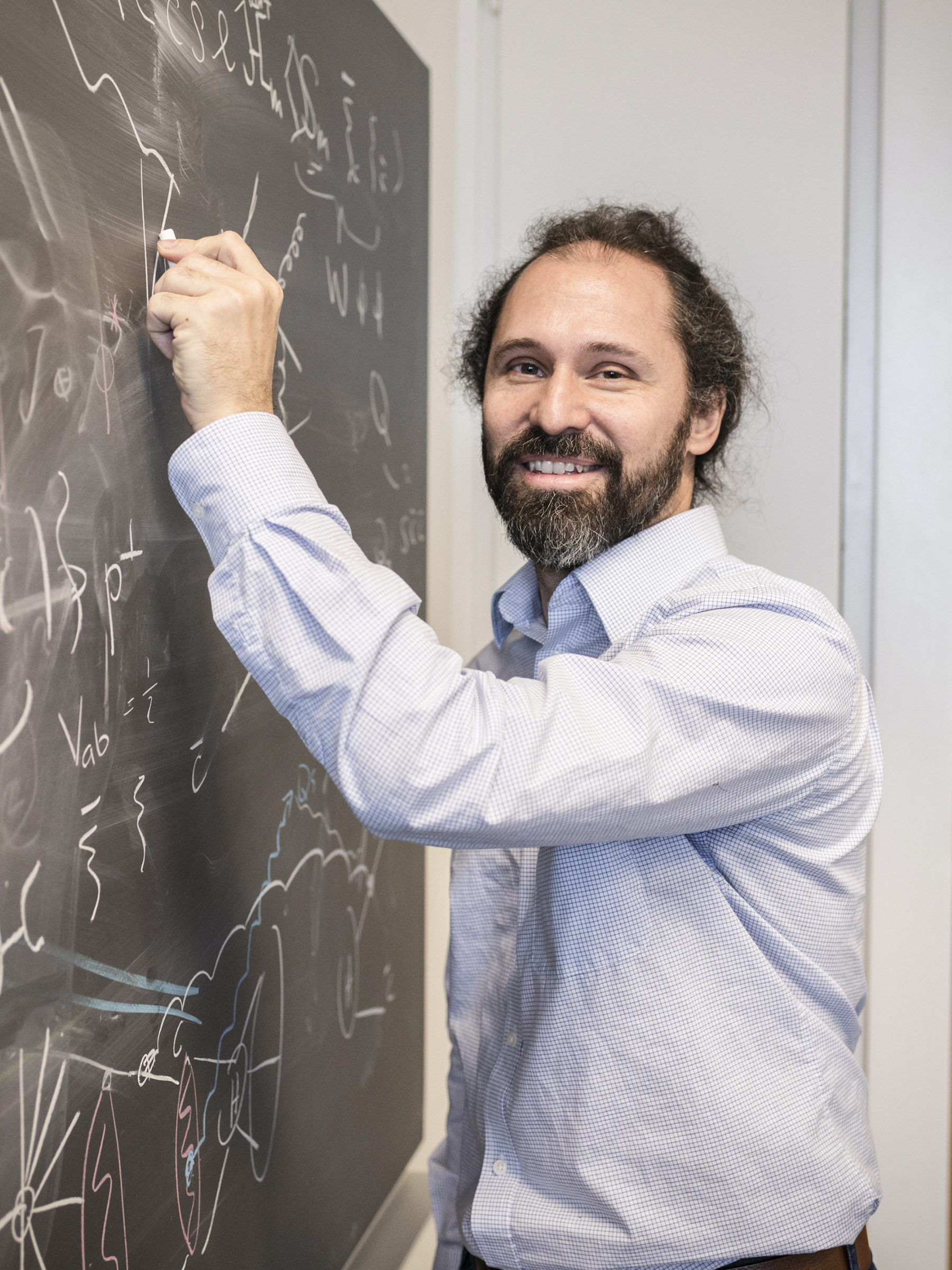«Physik am Freitag»: Uraltes Eis und Sonnenstürme
Bei der Vortragsreihe «Physik am Freitag» der Universität Bern präsentieren Forschende aktuelle Themen aus der Welt der Physik. Zum Vortragsprogramm 2025 gehören Themen wie die Suche nach dem ältesten Eis in der Antarktis, der Physik-Nobelpreis 2024 oder die Suche nach fremden Welten ausserhalb des Sonnensystems. Start der Reihe ist am 28. Februar 2025.
Mit «Physik am Freitag» präsentieren der Fachbereich Physik und das Albert Einstein Center for Fundamental Physics der Universität Bern wiederum aktuelle Themen und Forschungsergebnisse in Vorträgen für ein breites Publikum. «Unser Ziel mit dieser Vortragsreihe ist es, der Öffentlichkeit einen Einblick in verschiedene Bereiche der Forschung in Bern zu geben und neue Resultate in der Physik verständlich zu präsentieren», erklärt Prof. Dr. Thomas Becher vom Institut für Theoretische Physik und vom Albert Einstein Center for Fundamental Physics der Universität Bern. Die Vorträge sind öffentlich und kostenlos, werden auf Deutsch gehalten und dauern rund eine Stunde, gefolgt von einer Fragerunde. Die Veranstaltung richtet sich an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, Studierende sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Vorträge aus Astro-, Klima-, Teilchen- und Kernphysik sowie der angewandten Stochastik
Im ersten Vortrag wird Hubertus Fischer, Leiter der Abteilung für Klima- und Umweltphysik, über die Suche nach dem ältesten Eis in der Antarktis sprechen. Kürzlich hat ein internationales Team von Forschenden mit massgeblicher Beteiligung der Universität Bern erfolgreich einen 2’800 Meter langen und über 1,2 Millionen alten Eiskern erbohrt und damit das Grundgestein unter dem antarktischen Eisschild erreicht. Hubertus Fischer wird im Vortrag erklären, welche wichtige Rolle Eisbohrkerne in den modernen Klimawissenschaften spielen, wie Eis- und Warmzeiten zustande kommen, warum die Treibhausgase in der Atmosphäre als Rückkopplung dafür so wichtig sind, wie man einen 1,2 Millionen Jahre alten Eisbohrkern findet und erbohrt und was man mithilfe physikalischer Verfahren über das Klima der letzten 1,2 Millionen Jahre lernen kann.
Im zweiten Vortrag wird Daniel Kitzmann von der Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie der Frage nachgehen, wie Planeten entstehen und ob es ausserhalb unseres Sonnensystems bewohnbare Planeten gibt. Diese Fragen stehen seit langem im Fokus der Astrophysik. Kitzmann wird erläutern, wie die Entdeckung von tausenden extrasolaren Planeten es uns erstmals erlaubt, unser Sonnensystem direkt mit anderen Planetensystemen zu vergleichen. Was bedeuten die neuen Erkenntnisse für unseren Heimatplaneten und seinen Platz im Universum? Wie sieht die Zwischenbilanz der Exoplanetologie aus? Haben wir Exemplare gefunden, welche der Erde ähneln oder sind die Planeten in fremden Sternensystemen völlig anders?
Der dritte Vortrag von Andrea Agazzi, Professor für Angewandte Stochastik, dessen Forschung sich unter anderem auf die Untersuchung von Modellen und Phänomenen in der künstlichen Intelligenz konzentriert, ist dem Physik-Nobelpreis 2024 gewidmet. Dieser wurde an den US-amerikanischen Physiker John J. Hopfield und den britischen Informatiker und Kognitionspsychologen Geoffrey E. Hinton verliehen, die die Grundlagen der künstlichen Intelligenz entwickelt haben. Im Vortrag wird Agazzi über maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke sprechen und erklären, wie diese funktionieren und was wir in Zukunft noch erwarten können.
Im vierten Vortrag wird Fernando Romero-López vom Institut für Theoretische Physik eine Einführung in die theoretischen Vorhersagen der Teilchen- und Kernphysik geben. Atomkerne bilden den Grossteil der Materie im sichtbaren Universum. Dennoch bleiben theoretische Vorhersagen ihrer Eigenschaften eine grosse Herausforderung. Dank der leistungsstärksten Computer der Welt wurden in den letzten Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte in diesem Forschungsgebiet erzielt.
Im fünften Vortrag erklärt Lucia Kleint vom Astronomischen Institut, was es mit Weltraumwetter und Sonneneruptionen auf sich hat. In ihrer Forschung untersucht sie gewaltige Sonnenstürme, die auf der Erde für erhebliche Probleme sorgen können. Eruptionen auf der Sonne können Energien freisetzen, welche millionenfach grösser sind als jene von Vulkanausbrüchen. Der Einfluss von Sonneneruptionen auf die Erde wurde erstmals 1859 erkannt. Auf dieses Ereignis, das nur wenige Minuten auf der Sonne andauerte, folgte intensives Weltraumwetter mit Polarlichtern, die fast bis zum Äquator sichtbar waren. Die Folgen von Weltraumwetter können aber weitaus gefährlicher sein: sie reichen von Satellitenabstürzen über Stromausfällen bis hin zu GPS- und Kommunikationsstörungen.
Medienschaffende sind herzlich zu den «Physik am Freitag»-Vorträgen eingeladen:
| Datum | Jeweils am Freitag um 16.30 Uhr (siehe Vortragsdaten in der Tabelle unten) |
| Ort | Universität Bern, Gebäude Exakte Wissenschaften (ExWi), Sidlerstrasse 5, 3012 Bern, Hörsaal 099 |
Eintritt frei, Vortragssprache Deutsch
Programm:
| 28.02.2025 | Hubertus Fischer | Klimaphysik Bern – Die Suche nach dem ältesten Eis in der Antarktis |
| 14.03.2025 | Daniel Kitzmann | Extrasolare Planeten – Die Suche nach fremden Welten ausserhalb des Sonnensystems |
| 28.03.2025 | Andrea Agazzi | Physik-Nobelpreis 2024 – Die Grundlagen der künstlichen Intelligenz |
| 02.05.2025 | Fernando Romero-López | Mit den weltgrössten Computern ins Innere der Atomkerne |
| 09.05.2025 | Lucia Kleint |
Mehr Informationen zur Veranstaltung: Siehe Flyer bei den Downloads oder https://www.physik.unibe.ch/ueber_uns/aktuell/physik_am_freitag/index_ger.html
20.02.2025